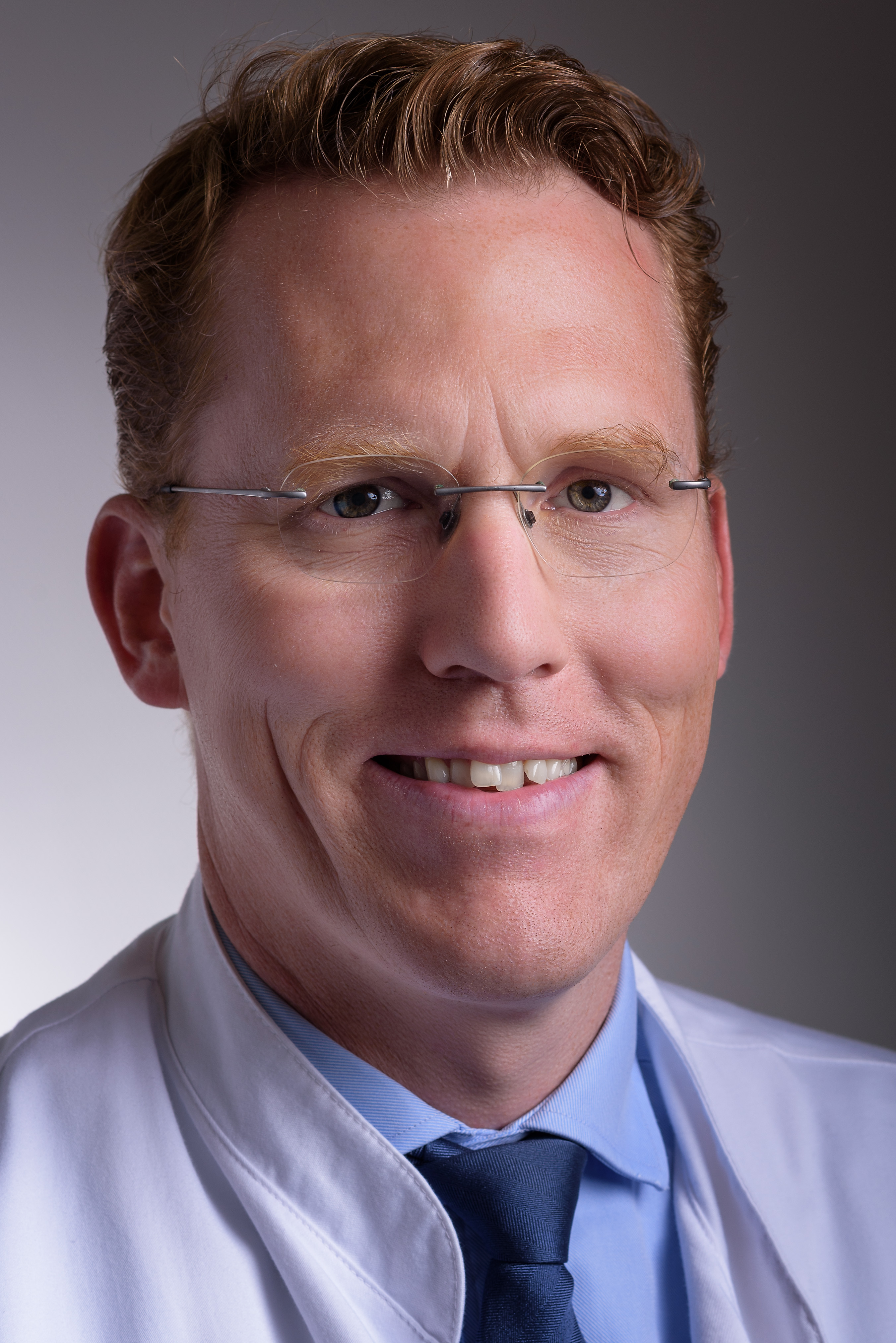Wer an Parkinson leidet, weiß um die belastenden Umstände, die die Krankheit irgendwann begleiten: Zittern, Bewegungsarmut, Steifheit. All diese Symptome führen zu einem ausgeprägten Verlust an Lebensqualität. Obwohl die Medizin immer neue Behandlungsmethoden entdeckt, ist es derzeit noch nicht möglich, die Krankheit im Keim zu ersticken.
Man ist allerdings in der Lage, vielen Patienten über viele Jahre hinweg „sehr gut zu helfen“, wie Professor Dr. Lars Timmermann sagt. Er ist Direktor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Gießen und Marburg am Standort Marburg, die als erste und einzige Einrichtung in Deutschland als „Center of Excellence“ der Parkinson’s Foundation zertifiziert worden ist.
Weltweit gut vernetzt, behandelt der Mediziner nicht nur seine pro Jahr mehreren Hundert stationären Patienten, sondern forscht auch aktiv über Parkinson.
Neben der klassischen medikamentösen Therapie spricht Timmermann im Gespräch mit dem RHÖN-Gesundheitsblog auch über die kontinuierliche Pumpentherapie und die Tiefe Hirnstimulation, die schon zu erstaunlichen Ergebnissen geführt hat und von vielen Patienten wie Zauberei empfunden wird.

Der Mediziner rät allen Menschen, die von Parkinson betroffen sind, sich in eine Klinik mit viel Erfahrung zu begeben, um möglichst frühzeitig feststellen zu lassen, für welche Therapieform man selbst am besten geeignet ist.
Herr Professor Timmermann, wer ist eigentlich grundsätzlich von Parkinson betroffen?
Morbus Parkinson, wie die Krankheit wissenschaftlich bezeichnet wird, ist eine Erkrankung, die vor allem ältere Menschen betrifft. Nur etwa jeder zehnte Patient ist vor dem 40. Lebensjahr erkrankt.
Ist Parkinson vererbbar?
Es gibt ganz bestimmt einen sogenannten genetischen Trade: In Familien, in denen viel Parkinson vorkommt, ist also die Wahrscheinlichkeit, irgendwann von der Erkrankung betroffen zu sein, deutlich höher. Die meisten Patienten haben aber keine Verwandten, die vorher schon Parkinson gehabt haben.
Ärzte sollen inzwischen wesentlich besser helfen können als früher…
Ja. Früher war Parkinson eine schwere Diagnose. Viele Patienten sind nach zehn Jahren Erkrankung schon schwer krank gewesen, oder sogar gestorben. Heutzutage ist das nicht mehr der Fall. Im Gegenteil, wir können unsere Patienten über viele Jahre hinweg außerordentlich gut helfen und damit auch deren Perspektive deutlich besser gestalten.
Woran liegt das?
Wahrscheinlich ist der Mechanismus relativ simpel. Und das, obwohl sein Entstehen im Bereich von Stoffwechselprozessen sehr komplex sein kann.
Worum geht es bei Parkinson im Detail?
Der Hauptmechanismus ist wahrscheinlich, dass Eiweiße zusammenklumpen, und diese Klumpen irgendwann nicht mehr ordentlich auseinandergespalten werden. Somit passen sie, bildlich gesprochen, nicht mehr in die dafür vorgesehenen „Mülltonnen“ der Zellen hinein.
Welche Folgen hat das?
Wenn die „Sperrmüllabfuhr“ nicht kommt und die Garage voll ist, besteht Erstickungsgefahr. In diesem Fall für die Zelle. Sie geht zugrunde. Zellen, die besonders aktiv sind und demzufolge einer erhöhten Stoffwechselaktivität bedürfen, sind offenbar ganz besonders früh betroffen. Eine ganz entscheidende Zellengruppe in unserem Gehirn ist diejenige, die das produziert, was man als „Schokolade unseres Gehirns“ bezeichnen könnte: das Dopamin.
Welche Rolle spielt es?
Das ist ein Botenstoff, der für viele Prozesse nötig und wichtig ist. Es ist die „Belohnungssubstanz“. Wenn wir uns zum Beispiel über ein Tor beim Fußball freuen, schüttet unser Gehirn jede Menge Dopamin aus. Das fühlt sich unglaublich gut an. Wir Menschen brauchen das. Wir brauchen Dopamin allerdings auch, um uns flüssig zu bewegen. Und viele Dinge, die wir ja auch parallel machen, also Sprechen, Laufen, Interagieren, Beobachten, müssen schnell, flüssig, zügig und aufeinander abgestimmt funktionieren.
Und genau das klappt ohne Dopamin eben nicht?
Wenn man zu wenig Dopamin hat, läuft man quasi leer. Das ist für viele Patienten ein relevantes Problem. Denn wir wissen, dass Parkinson-Patienten oft schon sieben Jahre oder länger krank sind, also lange bevor sich die ersten offensichtlichen Anzeichen des Parkinson entwickeln. Wenn der Verlust von Dopamin dann irgendwann so groß ist, dass er nicht mehr ausgeglichen werden kann, dann kommt es häufig dazu, dass die Patienten die ersten Ausfälle erleiden.
Wie äußert sich das im Alltag?
Das macht sich zum Beispiel bemerkbar an einer Verlangsamung von Bewegungen, einer erhöhten Steifheit. Muskeln können oftmals kaum mehr bewegt werden. Typisch für die Krankheit ist auch das Zittern, das ein bisschen so aussieht, als wenn man Geldscheine zählt. Zudem kann es sein, dass die Mimik verarmt. Diese Symptome gehen einher mit einem ganzen Strauß weiterer.
Viele Patienten haben zum Beispiel zuvor schon über Jahre Verstopfung gehabt, weil Botenstoffe auch im Magen-Darm-Trakt mitreagieren. Manche bemerken auch, dass die Stimmung nicht mehr so gut ist, dass ihnen im Alltag der Antrieb fehlt, bestimmte Dinge zu tun. Außerdem bemerken manche Patienten ganz erstaunliche Dinge, wie etwa eine Riechstörung, die sehr früh in der Krankheit auftreten kann, und auch schon vor der Erkrankung. Auffällig ist ebenfalls manchmal eine Änderung im Schlafverhalten. Zum Beispiel werden Träume wild ausagiert. All diese Symptome sind in der Summe für die Patienten natürlich eine außerordentliche Belastung, was ihre Lebensqualität angeht.
Wie kann die Medizin da helfen?
Bei älteren Patienten können wir viele der Probleme in den ersten Jahren sehr gut durch Medikamente auffangen. Die meisten Präparate, die wir geben, ersetzen letztlich im Gehirn fehlendes Dopamin. Dieses Ersatzprodukt ist nicht so gut wie das körpereigene, macht seine Sache aber nicht schlecht.
Welche Optionen der Behandlung gibt es jenseits der medikamentösen Therapie?
Neben dem Dopamin-Ersatz versuchen wir als Wissenschaftler natürlich, den Prozess eines voranschreitenden Parkinson aufzuhalten, das Problem also an der Wurzel anzupacken. Es gibt mittlerweile viele interessante Ansätze, und ich habe die Hoffnung, dass wir unseren Patienten in den kommenden Jahren noch viel bieten können, was momentan noch nicht abschließend möglich ist.
Können Betroffene auch selbst zu einer Besserung der Symptome beitragen?
Neben der Einnahme von Medikamenten ist es wichtig, dass die Patienten körperliche Funktionen trainieren, also eben Bewegung, Balance, Fingerfeinmotorik, und so weiter. Deswegen sind intensive Trainingsprogramme wichtig. Gerade für ältere Patienten, die sich oft ohnehin nicht mehr so viel bewegen.
Bei manchen Patienten schlagen Medikamente bekanntermaßen irgendwann nicht mehr an. Ist das auch bei der Behandlung von Parkinson so?
Durchaus. Zuweilen bemerken wir als Ärzte, dass wir bei manchen Patienten an einem Punkt sind, an dem quasi „das Ende der Fahnenstange erreicht ist“. Junge Patienten merken oft nach ungefähr sieben Jahren, dass die Last der Krankheit dazu führt, dass sie ihren Alltag nicht mehr richtig in den Griff bekommen.
Welche Behandlungsoptionen gibt es dann noch?
Es gibt bestimmte Vorgehensweisen, die wir hier am Universitätsklinikum Gießen und Marburg am Standort Marburg anwenden und die mittlerweile auch international anerkannt sind. Wenn also die einzelne Tablette nicht mehr in der Lage ist, den Patienten dauerhaft von einer schlechten in eine gute Beweglichkeit zu bringen, dann liegt das vielleicht daran, dass er – immer etwas braucht. Also quasi jede Minute. Und nicht nur alle vier Stunden.
Hört sich sehr aufwändig an. Wie kann das funktionieren?
Mittlerweile können wir unseren Patienten Medikamente über Pumpen zuführen. Das bedeutet also, dass ihnen jede Minute ein Medikament wie Apomorphin unter die Haut gespritzt wird. Die Pumpe läuft ganz automatisch den ganzen Tag über durch, sodass die Patienten nie ohne Medikation sind. Das funktioniert wunderbar, wenn man einen Schlauch an derjenigen Stelle anlegt, an der das Parkinson-Hauptmedikament L-Dopa vom Körper aufgenommen wird. Auf diese Weise ist wirklich jede Minute ausreichend Parkinson-Medikament im Blut.
Viele Patienten wollen aber sicherlich nicht ständig eine Pumpe um den Hals tragen…
Das ist natürlich nachzuvollziehen. Und deswegen gibt es daneben seit einigen Jahrzehnten mit der sogenannten Tiefen Hirnstimulation ein Konzept, das ebenfalls sehr gut helfen kann.
Was macht diese Therapie genau?
In unserem Gehirn kommunizieren verschiedene Areale ständig miteinander. Gemeinsam sind sie in der Lage, Aufgaben wie Sprache, Verstehen, Bewegen oder Nachdenken miteinander zu lösen. Das tun sie anhand einer sehr differenzierten Kommunikation. Das heißt, dass auf verschiedenen Kanälen in sehr schnellem Takt miteinander „gesprochen“ wird. Was beim Parkinson passiert, ist, dass sich dieser Takt deutlich verlangsamt, sehr viel gröber wird und sehr viel weniger Informationsfluss erlaubt.
Also kommt es zunehmend zum Stillstand…
Sagen wir es so: Die Aufgabe sich zu bewegen, nachzudenken, gewissen Dinge nachzufühlen – das alles ist plötzlich nicht mehr möglich. Weil die Hirnareale untereinander viel zu wenig „sprechen“ können. Um dieses Ungleichgewicht zwischen verschieden Hirnarealen zu stoppen, muss man diesen krankhaften Rhythmus unterdrücken.
Wie funktioniert das?
Hier bietet es sich natürlich grundsätzlich an, mit etwas zu arbeiten, mit dem das Gehirn von Natur aus hantiert: Elektrizität. Im Kopf springt ein Stromimpuls von einer Nervenzelle auf die nächste über. Und genau das versuchen wir mit Elektroden nachzustellen, die von uns im Kopf verankert werden.
Es ist alles andere als trivial, weil man natürlich wissen muss, wo im Gehirn das Netzwerk genau verortet ist. Und wo man ansetzen muss, damit der krankhafte Rhythmus im Gehirn, der Parkinson ausmacht, wieder zu einem guten Rhythmus wird. Das erfordert sehr detaillierte Kenntnisse.
Wie weit sind Sie als Wissenschaftler und ihren Kollegen weltweit auf diesem Gebiet?
Immerhin kennen wir inzwischen ziemlich genau die Zielareale und auch die Stimulationsmuster, mit denen man elektrische Impulse abgeben muss, um die krankhafte Aktivität im Gehirn zu unterdrücken. Dazu braucht man spezialisierte Neurochirurgen, die sich im Gehirn bestens auskennen, und große MRT-Maschinen, mit denen man das Gehirn in feinsten Scheiben dreidimensional darstellen kann.
Es geht also quasi darum, den passenden „Zufahrtsweg“ zu den entscheidenden Hirnarealen zu finden…
Dann erst erlaubt es die genannte Behandlungsoption der Tiefen Hirnstimulation, vorbei am Hirngewebe einen feinen Draht an eine Stelle zu legen, an der die krankhafte Aktivität quasi laut herausgebrüllt wird. Dann fangen wir an, mit vorsichtigen, feinen Pulsen an dieser Stelle die Nervenzellen zu beeinflussen – und auf diese Weise die krankhafte Aktivität zu unterdrücken.
Welche Erfahrungen haben Sie mit dieser Tiefen Hirnstimulation gemacht?
Was mich als Arzt schon immer fasziniert hat, ist, dass aber einer gewissen Stromstärke das krankhafte Zittern tatsächlich aufhört. Oder die vorher steife Hand, die zuvor nur mit größter Mühe in Zeitlupe bewegt werden konnte, an Geschwindigkeit aufnimmt. Und wie beim Winken können viele Patienten ihre Hand wieder hin und her drehen. Ich hatte auch einen Patienten, der zuvor steif wie ein Brett war und seinen Arm kaum bewegen konnte. Er ist durch die Tiefe Hirnstimulation plötzlich wieder lockerer geworden.
Es ist ein absolut faszinierender Effekt, der auf Patienten mitunter wie Zauberei wirkt. Natürlich ist es keine Zauberei, sondern schlicht das Unterdrücken von krankhafter Hirnaktivität. Man kann bei vielen Patienten den Parkinson also wieder recht gut in den Griff kriegen.
Wenn das Erfolgsrezept so gut zu funktionieren scheint: Warum bekommt dann eigentlich nicht jeder Patient sofort eine Tiefe Hirnstimulation?
Wir haben über die Jahre die Erfahrung gemacht, dass es erst dann sinnvoll ist, die Tiefe Hirnstimulation zu benutzen, wenn schon erste Schwierigkeiten mit den Medikamenten auftauchen. Auch hat sich gezeigt, dass eine zu schnell angewendete Tiefe Hirnstimulation für den Patienten mehr Risiko als Nutzen bedeuten könnte. Auf der anderen Seite haben wir auch gemerkt, dass der Patient, wenn man zu lange wartet, vielleicht schon seinen Job verloren hat, oder gestürzt ist, mit möglicherweise schlimmen Folgen wie Knochenbrüchen.
Wie haben Sie sich letztlich entschieden?
Ein guter Kandidat ist offensichtlich ein Patient, bei dem die ersten Einschränkungen zum Problem werden. Und auch jemand, bei dem das Dopamin-Ersatzpräparat L-Dopa gut anschlägt. Wenn also die Medikamente gut wirken, wirkt offenbar auch die Tiefe Hirnstimulation.
Welche Patienten behandeln Sie nicht mit der Tiefen Hirnstimulation?
Schwierigkeiten gibt es mit Menschen, die Probleme mit Gedächtnis und Konzentration haben. Hier mussten wir lernen, dass es sich um Personen handelt, die oftmals nach der Tiefen Hirnstimulation Komplikationen bekommen haben, wie zum Beispiel Verwirrtheitszustände. Und deswegen screenen wir vor der Anwendung der Tiefen Hirnstimulation sehr genau. Außerdem haben wir gelernt, dass Patienten, die frühzeitig Verhaltensänderungen aufgewiesen haben, durch die Therapie möglicherweise Probleme bekommen können. Das ist zum Beispiel bei Menschen der Fall, die vor der Therapie depressiv waren. Das gibt es beim Parkinson gar nicht so selten, und das kommt bei Frauen häufiger vor als bei Männern.
Wer führt dieses Screening effektiv durch?
Herauszufinden, welcher Patient für die Tiefe Hirnstimulation geeignet ist, und wer nicht, das übernehmen wir Neurologen. Das tun wir jede Woche mit einer Reihe von Patienten. Daneben braucht es natürlich ein technisch bestens ausgestattetes und hoch trainiertes neurochirurgisches Team, das ergänzt wird durch Neurologen und Vertreter anderer relevanter Berufsgruppen. Wenn man gut im Training ist und die Prozesse oft durchspielt, sind die Komplikationen sehr gering und der Erfolg sehr hoch.
Wie wird sich die Behandlung von Parkinson in den kommenden Jahren und Jahrzehnten verändern?
Was sich jetzt schon sagen lässt, ist, dass neben ärztlicher Erfahrung in diesem Feld schon aktuell Künstliche Intelligenz eine immer größere Rolle spielt. Das ist ein faszinierendes Forschungsfeld, auf dem wir unsere Algorithmen mit Einzelinformationen füttern und sie so immer intelligenter machen.
Mit welchem Ziel?
Die Technologie könnte zum Beispiel jungen Ärzten, die noch nicht so viel Erfahrung haben, nahelegen, welche Therapie für einen bestimmten Patienten die richtige ist bzw. sein könnte. Das ist auch deshalb wichtig, weil der Parkinson bei vielen Patienten sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Helfen kann die Künstliche Intelligenz auch bei der Entwicklung von mathematischen Verfahren. Da geht es darum, zu klären, was die Krankheit in bestimmten Momenten mit unserem Gehirn macht. Hierzu messen wir Nervenströme, sehen uns die Netzwerke von verschiedenen Hirnarealen an, und prüfen, wie diese miteinander interagieren.
Ihr Experte für Parkinson
Prof. Dr. Lars Timmermann
Direktor der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Gießen und Marburg am Standort Marburg